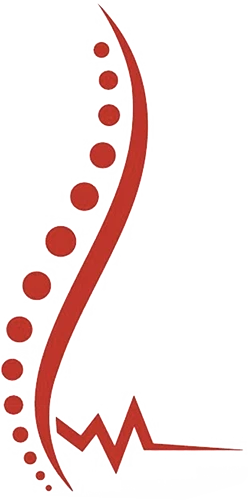Was ist Palliativmedizin?
Begleitung in der letzten Lebensphase
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Palliativmedizin wie folgt: Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten, mit einer progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf kurative Behandlung anspricht und die Beherrschung der Schmerzen, anderer Krankheitsbeschwerden, psychologischer, sozialer und spiritueller Probleme höchste Priorität besitzt.
Die Definition der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP):
entspricht im Wesentlichen der WHO-Definition, ist aber wesentlich kürzer: Palliativmedizin ist die Behandlung von Patienten mit einer nicht heilbaren progredienten und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, für die das Hauptziel der Begleitung die Lebensqualität ist. Palliativmedizin soll sich dabei nicht auf die letzte Lebensphase beschränken. Viele Grundsätze der Palliativmedizin sind auch in frühen Krankheitsstadien zusammen mit der kausalen Therapie anwendbar. Palliative Zielsetzungen können in verschiedenen organisatorischen Rahmen sowohl im ambulanten wie im stationären Bereich verfolgt werden.

Palliativstationen und Stationäre Hospize:
ermöglichen eine Behandlung bei Patienten, die im ambulanten Bereich nicht ausreichend zu behandeln sind oder dort nicht mehr versorgt werden können.
Tageshospize bieten vor allem die Möglichkeit der psychosozialen Betreuung, aber auch medizinische und pflegerische Maßnahmen (z.B. Verbandswechsel, Infusionen, Injektionen) können in einzelnen Fällen dort durchgeführt werden. Die umfassende Betreuung des Patienten und der Angehörigen erfordert ein multidisziplinäres Team, zu dem neben Pflegepersonal und Ärzten auch Sozialarbeiter, Psychologen, Seelsorger und Physiotherapeuten gehören.
Neben den hauptamtlich tätigen Mitarbeitern ist die Integration ehrenamtlicher Mitarbeiter für das Selbstverständnis des Hospizgedankens wichtig. Vor allem Laien, Mitglieder von Hospizinitiativen oder Angehörige ehemals betreuter Patienten gehören zu dieser Gruppe. Von einigen Einrichtungen werden „Trauergruppen“ angeboten. Sie begleiten und unterstützen die Trauerarbeit der Hinterbliebenen.
Was ist SAPV?
Ist eine zufriedenstellende Symptomkontrolle erreicht, sollte dem Patienten – falls erwünscht - ermöglicht werden, seinen letzten Lebensabschnitt in der vertrauten häuslichen Umgebung zu verbringen. Ambulante Dienste helfen, dieses den Patienten zu ermöglichen.
Sie begleiten Patienten und Angehörige, helfen bei der häuslichen Palliativpflege und koordinieren die verschiedenen ärztlichen, pflegerischen und sozialen Dienste. Die Angebote der einzelnen Dienste sind sehr unterschiedlich und reichen von der psychosozialen Betreuung bis hin zu einer umfangreichen medizinischen Versorgung. Eine qualifizierte Ausbildung in Palliativpflege und Symptomkontrolle ist dafür Voraussetzung.
Die Arbeit der ambulanten Dienste ist ohne ehrenamtliche Helfer nicht denkbar, da in der Regel nur wenige hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt sind. Für ambulante Palliativdienste sind ein hauptamtliches Team und die Erreichbarkeit rund um die Uhr zu fordern. Nur wenige ambulante Einrichtungen erfüllen zurzeit in Deutschland diese Kriterien.